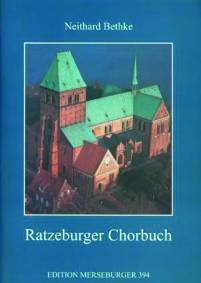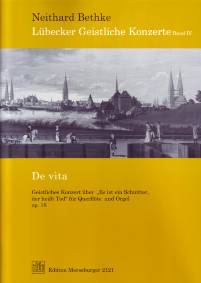KLEINE AUSZEIT - IM WINTER
Ein Raum für Andacht, Geist und Seele
Schneien
Robert Walser (1917)
Es schneit, schneit was vom Himmel herunter mag, und es mag erkleckliches herunter. Das hört nicht auf, hat nicht Anfang und nicht Ende. Einen Himmel gibt es nicht mehr, alles ist ein graues, weißes Schneien. Eine Luft gibt es auch nicht mehr, sie ist voll Schnee. Eine Erde gibt es auch nicht mehr, sie ist mit Schnee und wieder mit Schnee zugedeckt. Dächer, Straßen, Bäume sind eingeschneit. Auf alles schneit es herab und das ist begreiflich, denn wenn es schneit, schneit es begreiflicherweise auf alles herab, ohne Ausnahme.
Alles muß den Schnee tragen, feste Gegenstände wie Gegenstände, die sich bewegen, wie zum Beispiel Wagen, Mobilien wie Immobilien, Liegenschaften wie Transportables, Blöcke, Pflöcke und Pfähle wie gehende Menschen. Kein Fleckchen existiert, das vom Schnee unberührt bleibt, außer was in Häusern, in Tunneln oder in Höhlen liegt. Ganze Wälder, Felder, Berge, Städte, Dörfer, Ländereien werden eingeschneit. Auf ganze Staatswesen, Staatshaushaltungen schneit es herab.
Nur Seen und Flüsse sind uneinschneibar. Seen sind unmöglich einzuschneien, weil das Wasser allen Schnee einfach ein- und aufschluckt, aber dafür sind Gerümpel, Abfällsel, Hudeln, Lumpen, Steine und Geröll sehr veranlagt, eingeschneit zu werden. Hunde, Katzen, Tauben, Spatzen, Kühe und Pferde, sind mit Schnee bedeckt, ebenso Hüte, Mäntel, Röcke, Hosen, Schuhe und Nasen. Auf das Haar von hübschen Frauen schneit es ungeniert herab, ebenso auf Gesichter, Hände und auf die Augenwimpern von zur Schule gehenden zarten kleinen Kindern. Alles, was steht, kriecht, läuft und springt wird sauber eingeschneit. Hecken werden mit weißen Böllerchen geschmückt, farbige Plakate werden weiß zugedeckt, was da und dort vielleicht gar nicht schade ist. Reklamen werden unschädlich und unsichtbar gemacht, worüber sich die Urheber vergeblich beklagen.
Weiße Wege gibt´s, weiße Mauern, weiße Äste, weiße Stangen, weiße Gartengitter, weiße Äcker, weiße Hügel und weiß Gott was sonst noch alles. Fleißig und emsig fährt es fort mit Schneien, will, scheint es, gar nicht wieder aufhören. Alle Farben, rot, grün, braun und blau, sind vom Weiß eingedeckt. Wohin man schaut ist alles schneeweiß. Und still ist es, warm ist es, weich ist es, sauber ist es. Sich im Schnee schmutzig zu machen, dürfte sicher ziemlich schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich sein. Alle Tannenäste sind voll Schnee, beugen sich unter der dicken weißen Last tief zur Erde herab, versperren den Weg.
Den Weg? Als wenn es noch einen Weg gäbe! Man geht so, und indem man geht, hofft man, dass man auf dem besten Weg sei. Und still ist es. Das Schneien hat alles Geräusch, allen Lärm, alle Töne und Schälle eingeschneit. Man hört nur die Stille, die Lautlosigkeit, und die tönt wahrhaftig nicht laut. Und warm ist es in all dem dichten weichen Schnee, so warm, wie in einem heimeligen warmen Wohnzimmer, wo friedfertige Menschen zu irgendeinem feinen lieben Vergnügen versammelt sind. Und rund ist es, alles ist rundherum wie abgerundet, alles Harte, Grobe, Holperige ist mit Gefälligkeit, freundlicher Verbindlichkeit, mit Schnee zugedeckt. Wo du gehst, trittst du nur auf Weiches, Weißes und was du anrührst, ist sanft, naß und weich.
Verschleiert, ausgeglichen, abgeschwächt ist alles. Wo ein Vielerlei und Mancherlei war, ist nur noch eines, nämlich Schnee; und wo Gegensätze waren, ist ein Einziges und Einiges, nämlich Schnee. Wie süß, wie friedlich sind alle mannigfaltigen Erscheinungen, Gestalten miteinander zu einem einzigen Gesicht, zu einem einzigen sinnenden Ganzen verbunden. Ein einziges Gebilde herrscht. Was stark hervortrat, ist gedämpft und was sich aus der Gemeinsamkeit emporhob, dient im schönsten Sinne dem schönen, guten erhabenen Gesamten.
Aber ich habe noch nicht alles gesagt. Warte noch ein wenig. Gleich, gleich bin ich fertig. Es fällt mir nämlich ein, dass ein Held, der sich tapfer gegen eine Übermacht wehrte, nichts von Gefangengabe wissen wollte, seine Pflicht als Krieger bis zu allerletzt erfüllte, im Schnee könnte gefallen sein. Von fleißigem Schneien wurde das Gesicht, die Hand, der arme Leib mit der blutigen Wunde, die edle Standhaftigkeit, der männliche Entschluß, die brave tapfere Seele zugedeckt. Irgendwer kann über das Grab hinwegtreten, ohne dass er etwas merkt, aber ihm, der unterm Schnee liegt, ist es wohl, er hat Ruhe, er hat Frieden und ist daheim.- Seine Frau steht zu Hause am Fenster und sieht das Schneien, und denkt dabei: „Wo mag er sein, und wie mag es ihm gehen? Sicher geht es ihm gut.“ Plötzlich sieht sie ihn, sie hat eine Erscheinung. Sie geht vom Fenster weg, sitzt nieder und weint.
Verschneit liegt rings die ganze Welt
aus op. 69 "Der Jahrkreis"
Worte: Joseph von Eichendorff
am Klavier: O. Dribas
Verschneit liegt rings die ganze Welt, ich hab nichts, was mich freuet, verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreuet.
Der Wind nur geht bei stiller Nacht
und rüttelt an dem Baume,
Da rührt er seine Wipfel sacht
Und redet wie im Traume.
Er träumt von künftger Frühlingszeit,
Von Grün und Quellenrauschen,
Wo er im neuen Blütenkleid
Zu Gottes Lob wird rauschen.
Überwindung des Krieges
Carl Friedrich von Weizsäcker, 1976
Nicht weniger als die Überwindung der Institution des Krieges ist notwendig. Dies würde auch gelten, wenn die nächste welthistorische Krise uns nur auf eine Ebene brächte, in der bloß gewisse Kriegsformen ausgeschaltet wären. Uns ist heute der Blick durch die gesamte Zimmerflucht für einen historischen Moment soweit geöffnet , dass wir das nächste Zimmer, in das wir gelangen werden, nicht mehr für das letzte halten können.
Zwei Einsichten gehören zum fälligen Bewußtseinswandel: daß die Überwindung des Krieges notwendig ist, und daß sie möglich ist. Der logische Satz, daß das Notwendige eo ipso auch möglich ist, ist hier nicht anwendbar, denn es handelt sich um eine bedingte Notwendigkeit und Möglichkeit. Beide Einsichten sind gemeint unter der Bedingung, daß die historisch gewachsene Menschheitskultur weiterentwickelt und nicht zerstört wird. Es ist eine zusätzliche Behauptung, daß diese Bedingung erfüllbar ist. Wäre sie es nicht, so könnte das unter ihr Notwendige doch unmöglich sein.
Daß die Überwindung des Krieges notwendig ist, erscheint heutigen Menschen nur für eine Kriegsform evident: den Weltkrieg mit dem größten Waffeneinsatz. […] Aber eine Welt mit souveränen Großmächten, zwischen denen periodisch Kriege mit den dann jeweils modernsten Waffen geführt werden, erscheint nicht als eine stabile Ebene; sie wird in Weltfrieden oder Weltzerstörung übergehen. […]
Unsere Parallele führt alsbald zu der Frage, ob die Form der Kriegsüberwindung ein Weltstaat sein werde. In den direkt politischen Kapiteln dieses Buches sind wir zweimal, im wirtschaftlichen und im militärischen Teil, zur Konsequenz der Forderung einer staatsähnlichen Weltorganisation geführt worden. Gleichwohl haben wir diese Forderung dort nicht erhoben, aus zwei entgegengesetzten Gründen. Einerseits ist sie noch zu radikal. Sie ist heute utopisch, also kein Leitfaden der realen Politik. Andererseits ist sie nicht radikal genug. Sie konserviert die heutigen Problemlösungskonzepte und verallgemeinert sie nur auf ein planetarisches Maß. Hier müssen wir uns nun aber klarmachen, wie wahrscheinlich trotz dieser Einwände die Entstehung einer staatsähnlichen Weltordnung ist. Gerade wegen ihrer konservativen Züge ist sie eine mögliche politische Ebene, die sehr wohl das Ergebnis der nächsten großen weltpolitischen Krise sein könnte, zumal eines dritten Weltkrieges.
Es braucht nur einen Ruck im Denken, um den Phantasiemangel zu überwinden, der sich das, was es bisher in der Geschichte nicht gegeben hat, nicht vorstellen kann. Die Einführung des Ackerbaus, der Städte, der Großreiche, der Kirchen, der Technik waren keine kleineren Schritte, als es der Schritt zum Weltstaat wäre. Stärkere Waffen führen meist zu größeren Territorialstaaten, Hegemoniekonflikte zu Weltreichen, die einen Kulturkreis umfassen. Die kulturelle Angleichung der Weltteile aneinander vollzieht sich heute; sie ruft geradezu nach der politisch-organisatorischen Einheit. Vielleicht wäre die einheitliche Welt schwer zu regieren; also werden die Regierungsmethoden nicht schonend sein.
Evident ist, dass der Weltstaat eine Gefahr für die Freiheit und ein Promoter der Nivellierung der Kulturen wäre, und mit beiden eine Gefahr für die Quellen der Vernunft. Das Ziel, das wir unserem Bewußtseinswandel setzen, sollte also nicht sein, den Weltstaat zu erreichen, aber ebensowenig, ihn zu verhindern. Das Ziel sollte sein, Strukturen wachsen zu lassen, die ihn vielleicht ersetzen können, und die ihn, wenn er käme, erträglich machen würden. Es müssen Strukturen sein, die die Anwendung weltpolitischer Vernunft herausfordern und erleichtern. […].
Aus: Wege in der Gefahr, eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung, 1976, S. 261 ff
Variationen c-moll für Orgel
op. 6/1964
über eine eigene Choralmelodie zu „Du bist als Stern uns aufgegangen“ (Jochen Klepper)
Andreas Hoffmann, Gaida-Orgel der Kirche Herz Jesu in Wustweiler, 2. Variation (langsam und ausdrucksvoll)
EM 1839 | ISMN 979-0-2007-1638-2
KLEINE AUSZEIT - IM SOMMER
Wegzeichen
von Dietrich Heyde
Es ist merkwürdig mit uns Menschen. Wir schenken den Dingen umso größere Aufmerksamkeit, je seltener sie sind. Wenn aber etwas im Überfluß da ist – wie Steine zum Beispiel – dann gehen wir gedankenlos darüber hinweg. Eigentlich schade. Denn allem, was ist, wohnt eine Kraft und Aussage inne, die darauf wartet, von uns entdeckt zu werden.
Daran mußte ich denken, als ich auf Rügen nahe der Steilküste bei Saßnitz am Ufer entlagging. Es war übersäht von Steinen.Ich weiß nicht, wieviele Steine ich in die Hand nahm, um ihre Farben und Formen zwischen Licht und Wasser auch mit der Haut zu erfassen. Am Ende jedenfalls behielt ich zwei, einen Feuerstein und einen Donnerkeil. Später las ich, der Feuerstein habe sich vor Jahrmillionen in der Kreide gebildet; und der Donnerkeil sei das versteinerte Schwanzteil von urweltlichen Tintenfischen.
„Gefrorene Zeit“ (1) hat eine Dichterin die Steine einmal genannt. Sie sammeln „der Erdzeiten Stille“ (2) . Ihnen ist also die Kraft eigen, all das Vergangene, Zeiten und Geschehnisse, aufzubewahren. Sie bergen das Geheimnis von Jahrmillionen, das Geheimnis der Erinnerung.
Ich hatte plötzlich das Gefühl: Angesichts dieser uralten Steine und all dessen, was sie aufbewahren, wird die Weltgeschichte zu einem Atemzug und der Mensch mit seiner tief sitzenden Neigung, seine Zeit und sein Heute zu überschätzen, wieder heilsam klein und bescheiden. Steine lehren uns die wahre Größenordnung. Steine lehren uns, recht betrachtet, Geduld und Gelassenheit. Schon zwar zweitausendsechshundert Jahren empfahl der Prophet Jeremia: „Richte die Wegzeichen auf, setze dir Steinmale!“ (3)
Und noch etwas ging mir auf, was offensichtlich zur Weisheit der Steine gehört: Sie weisen uns hin auf unser kostbarstes Vermögen. Was das ist? Nein, nicht Geld oder Besitz, nicht Land oder Häuser, nicht dies und das, auch kein Wissen. Dein kostbarstes Vermögen ist das Erinnerungsvermögen. Die Erinnerung, die Vergangenes speichert, wie die Steine das auch tun. Je mehr noch, die all das Vergangene vergegenwärtigt und für dich lebendig und fruchtbar macht. Denn Erinnerung ist Leben, Zukunft. Sie gibt deinem Tag Tiefe, Bedeutung, Gewicht.
aus: Bilder von Himmel und Erde, Wachholtz-Verlag
(1) Nelly Sachs, Sternverdunkelung, Edition Suhrkamp 51, 1966, S. 146
(2) Nelly Sachs, In den Wohnungen des Todes, a.a.O. S. 92
(3) Jeremia 31,21
Bearbeitung der sechs Gellert-Lieder von Ludwig van Beethoven
op. 74/2006
für Sopran und großes Orchester
Christina Roterberg, Deutsches Bachorchester (live)
Meine Lebenszeit verstreicht, stündlich eil ich zu dem Grabe und was ist´s, dass ich vielleicht, dass ich noch zu leben habe?
Denk, o Mensch, an deinen Tag, säume nicht, denn eins ist Not.
KLEINE AUSZEIT - IM SOMMER 2022
Der Fluch des Krieges
von Anette Kurschus, Ratsvorsitzende der EKD
Wer einen anderen tötet, kommt von der Tat kaum mehr los. Denn allein die Opfer könnten vergeben. Doch eine Hoffnung gibt es.
Eine Krankenschwester erzählt von einem alten Mann, den sie einst gepflegt hat. Nacht für Nacht wälzte er sich im Bett, schreit, stöhnt, findet vor innerer Unruhe keinen Schlaf- obwohl die körperlichen Schmerzen gelindert sind. Warum? Er preßt die Lippen zusammen. Irgendwann geht sie ihn an, er solle endlich damit rausrücken, was ihn quäle. „Ich habe soviele umgebracht“, habe er stammelnd geflüstert und danach nicht mehr aufhören können zu weinen.
Der Krieg war lange vorbei, aber für diesen Mann war er eine nicht vergehende Vergangenheit. Die Menschen, die er tötete, suchten ihn heim und ließen ihn nicht los. „Wer Böses tut, kommt durch seine Bosheit um“, heißt es in der Bibel (Psalm 34,22). Mit der bösen Tat tut man nicht nur dem Opfer etwas an, sondern auch sich selbst. Überhaupt: läßt sich die Linie zwischen Opfern und Tätern so leicht ziehen? Ein ukrainischer junger Mann hat bei der Verteidigung seines Landes, zu der der Angriffskrieg ihn genötigt hat, einen russischen jungen Mann, der an die Front gezwungen wurde, erschossen. Ist er der Täter? Ist er Opfer? Jedenfalls ist er ein Mensch, der einen anderen Menschen getötet hat und dem dieser tote Menschenbruder ein Leben lang auf der Seele liegen wird. Wer einen Angreifer tötet, mag moralisch unschuldig sein und ist doch nicht gefeit vor schlaflosen Nächten und innerem Unfrieden.
Gewiss, nicht jeder leidet nachher Gewissensqualen. Paul Tibbets zum Beispiel, der Pilot, der die Atombombe über Hiroshima abwarf, war zeitlebens stolz auf seine Tat. „Ich hatte nie eine schlaflose Nacht, nur weil ich die Bombardierung befehligte“, bekannte Tibbets. Doch so unangefochten sind wohl die wenigsten. Gott sei Dank.
Das Bewußtsein, selbst getötet zu haben, läßt wohl innerlich kaum jemanden ungeschoren. Das mag an der gandenlosen Endgültigkeit des Todes liegen. Es gibt hier keine „Wiedergutmachung“. Dieses Wort hält in der Regel nur entfernt, was es verspricht. Gewiss, man kann und muß Tribunale durchführen, man kann und muß Strafen verhängen zur Sühne von Unrecht, Geld zahlen zum Ausgleich für Verluste, Häuser wieder aufbauen, manchmal schöner als zuvor. Tote jedoch werden nicht wieder lebendig.
Deshalb stöhnte jener alte Mann Nacht für Nacht in sein Kissen. Und deshalb gehen auch viele der Sieger aus einem gewonnenen Krieg als gefühlte Verlierer nach Hause. Das ist der Fluch des Krieges, der Fluch des Tötens. Es gibt keine Wiedergutmachung, selbst für den edelsten und stärksten Menschen nicht. Die Opfer allein könnten vergeben, sie allein könnten den erlösenden Freispruch gewähren. Aber die Toten bleiben tot, und wer wolle sich anmaßen, es an ihrer Stelle zu tun?
„Ich tue nicht das, was ich eigentlich will - das Gute. Sondern ich tue das, was ich nicht will – das Böse“: so beschreibt der Apostel Paulus die verzweifelte Unfähigkeit zum Guten. Die Sünde wohne in seinem Leib, so drastisch drückt er es aus; sein ganzer Körper sei ihr Gefangener. Paulus fleht: „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes?“ (Römer 7,19 ff) Und ich denke an den alten Mann, der sich in seinem Bett wälzt.
Es gibt keinen Vergebungsautomatismus, es gibt keine billige Gnade. Aber es gibt diese verzweifelte Einsicht, diese erschütterte Klage. Wir können mitklagen und dazu helfen, dass aus der Klage ein Ruf zu Gott wird, ein Stoßgebet. Ob und wie unser Gebet Antwort findet, liegt bei Gott. Wir haben kein Gewähr. Wir haben allein Christus, der für uns eintritt, und die tief gegründete Hoffnung, dass er alles gutmachen wird.
Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der EKD, erschienen in chrismon 5.2022
Ja, ich will euch tragen
aus dem Ratzeburger Chorbuch, op. 70
Ratzeburcher Domchor, Leitung: Neithard Bethke; Text: Jochen Klepper
Ja, ich will euch tragen, bis zum Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.
Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun. Will euch milde heben, ihr dürft stille ruhn.
Laßt nun eure Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug.
Erschienen im Ratzeburger Chorbuch, EM 394
KLEINE AUSZEIT - IM FRÜHJAHR
ich versuche seit achtundfünfzig tagen
erfolglos zu weinen
von Jule Weber
was mich in diesen tagen nicht zum weinen gebracht hat:
ein video, in dem ein hund stirbt
die sehnsucht nach so manchem
die außeinandersetzung mit dem, was passiert ist
ein gespräch über richtig echte liebe
grenzenlose müdigkeit
dienstage
selbstzweifel
der geburtstag eines geliebten, der lange schon fort ist
angestoßene fußzehen
überforderte wut
all das funktioniert ansonsten verlässlich
was mich in diesen tagen zum weinen gebracht hat:
zwiebeln schneiden
shampoo im auge
beides zählt bekanntlich nicht
manchmal fühle ich, wie sich mein mund verzieht
wie es mir heiß in meine augen steigt
mein puls sich messbar beschleunigt
und ich greif nach dem gefühl und halte es
dann kichert es leise und rinnt mir durch die finger
an manchen tagen fühlt sich es an
als hätte die gute laune mich meine tränen gekostet
eine salzige wüste hinterlassen
und da stehe ich jetzt und bin unendlich durstig
mein mund so trocken, dass ich gar nichts mehr sagen kann
achtundfünfzig tage warte ich auf die katharsis
denke zurück an diese vier guten minuten
die ich das neue jahr mit bitterlichem gejaule begrüßte
wie eine rakete, die sich zündet
aber niemals zum leuchten explodiert
was ich in diesen tagen empfunden habe:
jede nur vorstellbare emotion
wie sich all das geäußert hat:
hysterisches lachen
angespanntes schweigen
ungebrochenes gerede
katzengleiches fauchen
grabentiefes seufzen
abgefuckte schlaflosigkeit
ein kratzen an haut und herz und in der stimme
verstärkte verwendung von fluchwörtern
fuck ey
kann man echte traurigkeit auf ebay kaufen?
ich biete gerne allen grund dazu
immer ein bisschen mehr als davor gerade
drei
zwei
eins
an manchen tagen sehe ich andere leute weinen
und mache mir notizen in ein kleines heft
über grund der tränen, menge
und beschaffenheit, wie salzig, wie schwer
ich studiere die dichte und viskosität
an manchen tagen will ich einen klempner kontaktieren
weil ich denke, irgendwas ist nicht intakt
hausmittel könnten sein:
backpulver und zitronensaft,
laut internet kann das blockaden lösen
ich träufle mir wehmut unter die lider,
einmal hab ich sogar celine dion gehört
so oft hab ich nachts vom weinen geträumt
und bin aufgewacht voller erwartung,
voller traurigkeit auch, die nur in mir bleibt.
© Jule Weber 02/2021
De vita
Geistliches Konzert
Neithard Bethke, op. 18/1970; 3. Satz
Aufnahme Kreuzkirche Görlitz, 2018 Orgel: Olga Dribas, Querflöte: Katrin Paulitz
KLEINE AUSZEIT - IM FEBRUAR
Jesus - in schlechter Gesellschaft
von Jonathan Hahn, ev. Kirche Bernstadt
Die folgende Begebenheit trug sich zu an einem Sonntagvormittag, Anfang der 60er Jahre in den USA. Ein Schwarzer wollte einen Gottesdienst besuchen. Er kam zur Kirche und musste feststellen, dass es eine „weiße“ Kirchgemeinde war. Unter denen, die zur Kirchentür schritten, sah er nur Angehörige weißer Hautfarbe. Trotzdem gab er sich einen Ruck und ging auf die Kirchentüre zu. Er wurde befremdlich angeschaut. Als der in die Kirche eintreten wollte, wurde er vom Begrüßungsdienst angehalten. Ob er denn nicht sehen würde, dass hier nur Zutritt für Weiße gelte. Andere Rassen seien hier unerwünscht. Bevor der Schwarze wieder umkehren musste, sagte er schlagfertig: „Ich wollte eigentlich Gottesdienst feiern und Gott loben. Aber nun merke ich: In diesem Haus ist Er scheinbar gar nicht zu finden.“
Wo ist Gott zu finden? Diese Frage hat Jesus wie alle seine Zeitgenossen umgetrieben. Die Antwort Jesu fiel allerdings ganz anders aus als im offiziellen Mainstream: Gott ist auch dort zu Hause, wo man ihn nicht vermutet. Gott bewirkt Heilung auch in Sündern, Gaunern, Kranken, Verstoßenen, bei gierigen Steuereintreibern genauso wie bei Prostituierten. Jesus begab sich oft - sehr zum Ärger vieler - in schlechte Gesellschaft. Seine Runden mit dem Abschaum der Gesellschaft sind legendär. Für Jesus waren solche Tischgemeinschaften nicht weniger als ein Vorgeschmack auf das himmlische Reich.
Aber unter den Vorzeichen dieser Welt galt es als schlechte Gesellschaft. Jede Zeit und jede Gesellschaft definiert für sich neu, was „schlechte Gesellschaft“, was „schlechter Umgang“ ist.
Gesellschaften waren in sich schon immer uneins, nie homogen. Wenn heute von der „Spaltung der Gesellschaft“ geredet wird, sollte man das nicht vergessen. Schon immer wurden Trennlinien gezogen - gezielt oder unbewusst. Zwischen Juden und Ariern, zwischen Bonzen und Werktätigen, zwischen „Spaziergängern“ und Daheimbleibern.
Oder zwischen Sündern und Gläubigen, wie zur Zeit Jesu. Und ausgerechnet in dieser Zeit macht sich ein Soldat auf. Jesus selber ist vom Vertrauen dieses Menschen überrascht. Dieser Soldat, dieser Hauptmann von Kapernaun, ist gleich in dreierlei Hinsicht ein Feindbild: Er ist 1. Soldat der Besatzer: Er diente dem verhassten König Herodes Agrippa. Dieser ließ u.a. Johannes den Täufer hinrichten, der im Volk hochangesehen war. Der Hauptmann ist 2. ein Ungläubiger: Er betet zu den römischen Gottheiten Mars und Jupiter, nicht zu dem einen Gott. Und er ist 3. ein Ausländer: keiner aus Israel, sondern eben ein Heide. Dass ausgerechnet so einer zu Jesus kommt, dass er in aller Demut kommt, aber mit einem großen Vertrauen, das überrascht selbst Jesus. „Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: (…) „Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden.“
Man kann die Frage stellen, ob Jesus selber noch dazulernen musste. Er fühlte sich ja erst nur für das Volk Israel zuständig. Seine Sicht änderte sich jedoch im Laufe der Zeit. Er entdeckte, dass Gottes Ruf gesellschaftliche Konventionen aufbricht. Gottes Herz ist immer größer.
Und seitdem gilt für die Nachfolge in Jesu Fußspuren auch die Grenzüberschreitung im Tun und Denken. Wie wäre es, wenn wir nicht mehr daran arbeiten, unsere Sichtweisen richtig zu finden? Wie wäre es, sich bewusst mal in „schlechte Gesellschaft“ zu begeben? Gezielt mal wieder ein Kaffeetrinken auszumachen mit jemanden, von dem ich weiß: Wir haben uns über ganz unterschiedliche Sichtweisen voneinander entfremdet? Der Hauptmann von Kapernaum hat sich damals aufgemacht. Und Jesus hat sich innerlich geöffnet. Es kam zu einer folgenreichen Begegnung Damals passierte mehr als nur eine Horizonterweiterung.
Die Erfahrung Gottes im fremden Gegenüber. Und die ist oft so eindrücklich, dass sie das Leben prägt. Und den Glauben. Und den Nächsten. Amen.
De vita
Geistliches Konzert
Neithard Bethke, op. 18/1970; 4. Satz
Aufnahme Kreuzkirche Görlitz, 2018 Orgel: Olga Dribas, Querflöte: Katrin Paulitz
KLEINE AUSZEIT - ZUM NEUEN JAHR
Winston Churchill - Anfangen
Ich werde Ihnen nun von einer persönlichen Erfahrung berichten. Als ich Ende Mai 1915 aus der Admiralität ausschied, blieb ich weiterhin Mitglied des Kabinetts und des Kriegsrates. In dieser Position wusste ich alles und konnte nichts tun. Der Wechsel von der intensiven leitenden Tätigkeit, die jeden Arbeitstag bei der Admiralität ausfüllte, zu den sehr überschaubaren Aufgaben eines Beraters ließ mich nach Luft schnappen. Wie einem Tiefseebewohner im Netz oder einem zu rasch emporgezogenen Taucher drohten mir infolge des abfallenden Drucks die Adern zu platzen. Ich war voller Unruhe und nichts half mir, sie zu lindern; ich hatte vehemente Überzeugungen und wenig Macht, sie durchzusetzen.
Ich mußte zusehen, wie große Chancen unglückselig vertan wurden und Pläne, die ich angestoßen hatte und von denen ich zutiefst überzeugt war, nur zögerlich umgesetzt wurden. Ich hatte lange Stunden gänzlich ungewohnter Muße, um über die schreckliche Entwicklung des Krieges nachzudenken. Zu einem Zeitpunkt, in dem jede Faser meines Wesens zu handeln verlangte, war ich gezwungen, die Tragödie als Zuschauer zu erleben, dem man grausamerweise einen Platz in der ersten Reihe zugewiesen hatte. Da aber kam mir die Muße der Malerei zu Hilfe – aus Barmherzigkeit und Edelmut, denn eigentlich hatte sie ja nichts mit mir zu tun –, und fragte: „Kannst du mit diesen Spielzeugen etwas anfangen? Manchen gefallen sie.“
Einige Experimente mit dem Malkasten der Kinder, an einem Sonntag auf dem Land, brachten mich dazu, mir am nächsten Morgen eine komplette Ausrüstung für die Ölmalerei zu besorgen.
Nachdem ich Farbtuben, eine Staffelei und eine Leinwand gekauft hatte, galt es nun den nächsten Schritt zu tun und anzufangen. Aber welch ein Schritt ist das! Auf der Palette glänzten Farbkügelchen; rein und weiß bot sich mir die Leinwand dar; der unbefleckte Pinsel verharrte schicksalsträchtig, aber unentschlossen in der Luft. Ein stummes Veto schien meiner Hand Einhalt zu gebieten.
Allerdings war der Himmel zu diesem Zeitpunkt unbestreitbar blau, ein blasses Blau zudem. Folglich stand außer Zweifel, dass blaue Farbe, mit Weiß angemischt, auf den oberen Teil der Leinwand aufzutragen war. Um das zu erkennen, braucht man in der Tat keine künstlerische Ausbildung. Das ist der Ausgangspunkt, der jedermann offensteht. Also mischte ich mit einem sehr schmalen Pinsel ein wenig blaue Farbe auf der Palette an und setzte dann mit unendlicher Vorsicht einen etwa bohnengroßen Tupfen auf die pikierte schneeweiße Fläche. Es war eine Herausforderung, eine wohlüberlegte Kampfansage, aber so zaghaft, halbherzig und in der Tat so verkrampft, dass sie keine Antwort verdiente.
In diesem Augenblick war das deutliche Geräusch eines Autos zu hören, das in die Zufahrt einbog. Ihm entstieg rasch und behände niemand anderes als die talentierte Frau von Sir John Lavery. „Sie malen! Aber was zögern Sie? Geben Sie mir einen Pinsel – den großen da.“ Schwupp in das Terpentin getunkt, jäh auf das Blau und Weiß eingedroschen, hektisches Gefuchtel auf der – nun nicht mehr sauberen - Palette und dann mehrere ausholende Hiebe und Watschen von Blau quer über die nun vollends eingeschüchterte Leinwand. Jeder konnte sehen, dass sie unfähig war, zurückzuschlagen. Kein grimmiges Schicksal rächte den kecken Überfall. Hilflos grinsend stand die Leinwand vor mir. Der Bann war gebrochen. Die ungesunden Hemmungen verflogen. Ich ergriff den breitesten Pinsel und fiel mit der Rage eines Berserkers über mein Opfer her. Seitem habe ich nie wieder vor einer Leinwand Scheu empfunden.
Aus W. Churchill, „Zum Zeitvertreib“ Vom Lesen und Malen.
Altes Jahr, du ruhst in Frieden
aus op. 69/2012, Neithard Bethke
20 schlichte Lieder durch das Jahr nach zeitgenössischen und überlieferten Texten für entweder eine Solostimme und Klavier/Orgel oder vierstimmigen Chor
**
Klavier: O. Dribas
Altes Jahr, du ruhst in Frieden, deine Augen sind geschlossen. Bist von uns so still geschieden, hin zu himmlischen Genossen.
Und die neuen Jahre kommen, werden auch wie du vergehen. Bis wir alle aufgenommen uns im letzten wiedersehen.
Wenn dies letzte angefangen, deutet sich dies Neujahrgrüßen. Denn erkannt ist dies Verlangen, nach dem Wiedersehn und Küssen.
Einige Lieder aus dem "Jahrkreis" sind als Grußkarten erschienen. Hier gibt´s mehr dazu...